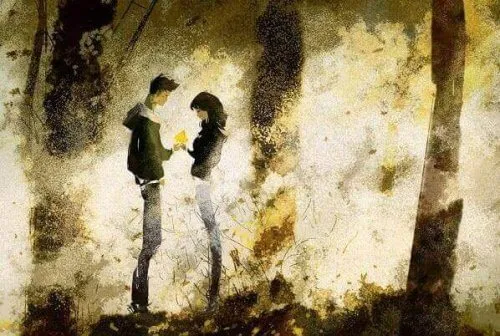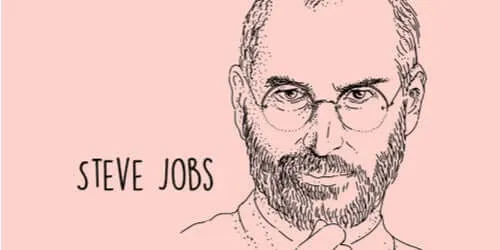Laut DSM-5 Zwischen 2 und 3 % der Bevölkerung in Europa und den Vereinigten Staaten leiden an einer Panikstörung. Es kommt bei Frauen doppelt so häufig vor wie bei Männern und die Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen ist am häufigsten betroffen. Aber was genau ist diese Störung? Was löst es aus und wie wird es behandelt?
Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Angststörung, die sehr behindernd sein kann und durch plötzliche Panikattacken und die Angst, sie erneut zu erleben, gekennzeichnet ist.
Angstartige Störungen Zusammen mit depressiven und drogenbedingten Störungen weisen sie weltweit die höchste Prävalenzrate auf. Durch ihre Sichtbarmachung wird das Bewusstsein für ihr Ausmaß und ihre Wirkung geschärft .

Definition und Symptome einer Panikstörung
Panikstörung ist eine Art von Angststörung, die gemäß DSM-5 charakterisiert wird ( Diagnostisches und statistisches Handbuch für psychische Störungen ) aus dem Wiederkehrendes Auftreten plötzlicher und unvorhersehbarer Panikattacken.
In den Momenten vor dem Angriff kann die Person ruhig oder ängstlich sein. Bei Panikstörungen hingegen fürchtet sich die betroffene Person, einen Anfall noch einmal zu erleben, der ihr Leben ernsthaft beeinträchtigt.
Doch was sind Panikattacken oder Krisen? Plötzliche und vorübergehende Episoden, in denen starke Gefühle von Angst, Unbehagen und Angst auftreten. Die Dauer ist variabel (ca. 15 Minuten); die maximale Intensität wird nach wenigen Minuten erreicht.
Die Symptome, die eine Panikattacke begleiten, sind unterschiedlich . Dazu gehören Schwitzen, Hyperventilation, Tachykardie, Zittern, Schwindel, Erbrechen und Übelkeit . Wir
Dissoziative Symptome wie z Derealisation (das Gefühl, dass das, was passiert, nicht real ist) und Depersonalisierung (das Gefühl, ein Fremder im eigenen Geisteszustand oder Körper zu sein).
Das Gewicht der Angst ist größer als das Übel, das sie verursacht.
– Anonym –
Ursachen einer Panikstörung
Was sind die Ursachen einer Panikstörung? Sie sind nicht immer bekannt und vielfältig . Beispielsweise kann die erste Panikattacke durch situative Faktoren ausgelöst werden. Die Angst vor einer Wiederholung der Krise kann jedoch mit einer negativen und negativen Interpretation körperlicher Empfindungen (die nichts mit Angst zu tun hat) verbunden sein.
Durch die Interpretation einiger körperlicher Empfindungen als angstauslösend können sich diese verstärken; Sie erzeugen daher mehr Angst und Unruhe und können zu einer Panikattacke führen.
Auch Die Genetik kann mit der Ätiologie der Panikstörung zusammenhängen . Menschen mit Familienmitgliedern, die an einer Angststörung leiden, haben ein höheres Risiko, eine solche zu entwickeln. Schließlich können Vorerfahrungen und das Erlernen bestimmter Verhaltensmodelle Einfluss auf die Entstehung einer Panikstörung haben.
Angst ist Unsicherheit auf der Suche nach Sicherheit.
– F. Krishnamurti –
Behandlung einer Panikstörung
Zu den wirksamen Psychotherapien bei Panikstörungen zählen die folgenden.
Mehrkomponentige kognitive Verhaltensprogramme
Zwei Programme haben sich bei der Behandlung von Panikstörungen als sehr wirksam erwiesen:
- Barlows Panikkontrollbehandlung (2007).
- Kognitive Therapie von Clark und Salkovskis (1996).
Barlow-Therapie beinhaltet die in vivo-Exposition gegenüber interozeptiven Empfindungen als zentrales Element der Intervention.
Die kognitive Therapie von Clark und Salkovski zielt darauf ab, fehlerhafte Empfindungen zu identifizieren, zu testen und zu modifizieren zugunsten realistischerer Modelle. Es besteht aus Elementen der Psychoedukation, der kognitiven Umstrukturierung, Verhaltensexperimenten, die auf der Induktion gefürchteter Empfindungen basieren, und nützlichen Ratschlägen zum Aufgeben von Sicherheitsverhalten.
Atemübungen
Darunter finden wir Chalkleys (1983) langsame Atemübungen gegen Panikattacken. Das Hauptziel besteht darin, eines zu lernen langsame und Zwerchfellatmung .
Derzeit jedoch Ihre Wirksamkeit als isolierte Intervention wird in Frage gestellt . Ideal ist es, diese Übungen in ein umfassenderes Programm einzubinden.
Entspannung angewendet
Bei Panikstörungen kommt vor allem Östs angewandte Entspannung (1988) zum Einsatz. Dem Patienten wird die progressive Muskelentspannung beigebracht ; Daher wird es dazu verwendet, sich zunächst schrittweise mit den körperlichen Empfindungen auseinanderzusetzen, die Panik auslösen können, und zweitens mit den Aktivitäten und Situationen, die die Person bisher gemieden hat.
In-vivo-Expositionstherapie
Eine der wirksamsten ist die Expositionstherapie von William und Falbo (1996). Der Patient wird im wirklichen Leben und auf systematische Weise den Situationen ausgesetzt, die er fürchtet und vermeidet .
Vagusstimulation gegen Panikstörung
Der vagale Stimulation von Sartory und Olajide (1988) versucht, die Herzfrequenz des Patienten mithilfe von Karotismassagetechniken zu kontrollieren. Ein Teil der Behandlung besteht darin, Druck auf das Auge auszuüben und gleichzeitig Luft aus der Lunge auszustoßen.
Intensivtherapie mit Fokus auf Empfindungen
Die Autoren dieser Therapie bei Panikstörungen sind Morisette Spiegel und Heinrichs (2005). UND eine Operation, die 8 aufeinanderfolgende Tage dauert . Ziel ist es, die Angst vor körperlichen Empfindungen zu beseitigen.
Zu diesem Zweck wird eine vollständige und nicht stufenweise Belichtung verwendet sich sofort den am meisten gefürchteten Empfindungen stellen . Die Exposition wird auch dadurch verbessert, dass durch körperliche Übungen körperliche Empfindungen hervorgerufen werden.
Akzeptanz- und Bindungstherapie
Innerhalb dieser Therapie namens ACT finden wir die am weitesten verbreitete kognitive Verhaltenstherapie gegen Panik nach Levitt und Karekla (2005).
Es besteht aus einem kognitiv-verhaltensbezogenen Standardverfahren, das eine situative und interozeptive Expositionspsychoedukation umfasst kognitive Umstrukturierung . Es sieht auch andere Elemente des ACT vor, wie z Achtsamkeit und die mögliche Steigerung nützlicher Aktivitäten zur Bekämpfung von Angstzuständen .

Pharmakotherapie
Die bei Panikstörungen eingesetzte und validierte Pharmakotherapie umfasst den Einsatz von Antidepressiva und Anxiolytika. Allgemein sind vorgeschrieben SSRIs wie Antidepressiva und Benzodiazepine oder Beruhigungsmittel als Anxiolytika.
Medikamente können helfen, Angstzustände zu lindern, aber das Ideal wird immer eine Behandlung sein, die Psychotherapie mit Pharmakotherapie kombiniert. Tatsächlich werden tiefgreifende Veränderungen immer mit angemessener psychologischer Unterstützung oder Therapie erreicht.
Mit anderen Worten: Die Pharmakotherapie kann beruhigen und den Grundstein dafür legen, mit der Behandlung der Störung zu beginnen. Jedoch Eine Psychotherapie ermöglicht es dem Patienten, seine Überzeugungen zu ändern und bestimmte Situationen und Empfindungen nicht mehr zu meiden.