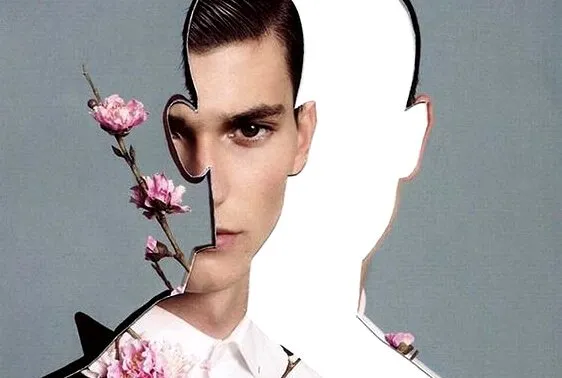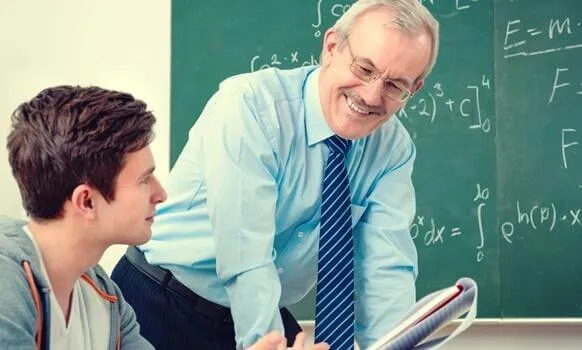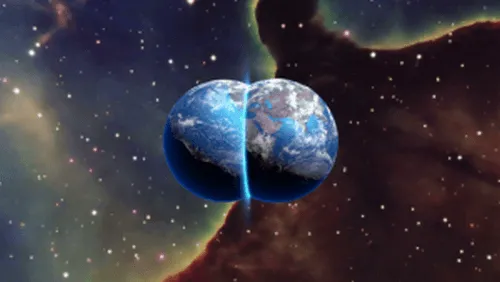Wir alle sind auf die eine oder andere Weise mit dem Konzept der Angst vertraut. Wir wissen, dass es jeden Menschen unterschiedlich betrifft und dass es unterschiedliche damit verbundene Störungen gibt. Eine davon ist die generalisierte Angststörung . Im DSM-5 Diagnostisches und statistisches Handbuch psychischer Störungen Angst wird auf unterschiedliche Weise definiert. Unter diesen finden wir die generalisierte Angststörung oder GAD.
Diese Störung ist durch übermäßige und anhaltende Ängste und Sorgen gekennzeichnet, die der Betroffene im Hinblick auf Ereignisse oder Aktivitäten, die mit drei oder mehr Symptomen einer physiologischen Übererregung einhergehen, nur schwer kontrollieren kann. Zur Diagnose von GAD Die Angst oder Sorge muss mindestens 6 Monate lang fast täglich vorhanden sein .
Die Entwicklung der generalisierten Angststörung (GAD)
Die DAG wurde ursprünglich als eingeführt Diagnostisches und statistisches Handbuch psychischer Störungen (DSM-III APA 1980). Allerdings wird es eher als Restdiagnose für Personen verwendet, die die diagnostischen Kriterien für andere Angststörungen nicht erfüllen (1).
In der Veröffentlichung des DSM-III-R wurde die DAG definiert als ein chronisches und allgegenwärtiges Problem (2). Später in der Veröffentlichung des DSM-IV-TR wurde die DAG als angegeben Übermäßige Ängste und Sorgen, die an den meisten Tagen mindestens sechs Monate lang im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Ereignissen und Aktivitäten auftreten .
Sorgen verursachen Stress und/oder Funktionseinbußen und sind mit mindestens drei der folgenden Faktoren verbunden:
- Unruhe, Anspannung oder Nervosität.
- Konzentrationsschwierigkeiten oder Gedächtnislücken.
- Reizbarkeit.
- Schlafveränderungen.
- Sie präsentieren a Mangel an Vertrauen in ihrer Fähigkeit, Probleme zu lösen.
- Sie nehmen Probleme als Bedrohung wahr.
- Sie sind frustriert, wenn sie mit einem Problem konfrontiert werden.
- Ich bin Pessimisten über das Ergebnis der Bemühungen zur Lösung des Problems.
- Der erste Faktor legt fest, dass Menschen, die an einer generalisierten Angststörung leiden, darunter leiden emotionale Übererregung oder Emotionen, die intensiver sind als die, die die meisten Menschen erleben. Dies betrifft sowohl positive als auch negative emotionale Zustände, insbesondere aber negative.
- Der zweite Faktor setzt voraus schlechtes Verständnis von Emotionen von Personen mit GAD. Dazu gehört ein Defizit in der Beschreibung und Kennzeichnung von Emotionen . Dazu gehört auch der Zugriff auf und die Anwendung nützlicher Informationen, die Emotionen betreffen.
- Im Vergleich zu mehr negative Einstellungen über Emotionen gegenüber anderen.
- Der vierte Faktor minimale oder keine adaptive Emotionsregulation von Personen, die über Bewältigungsstrategien verfügen, die möglicherweise zu emotionalen Zuständen führen, die schlimmer sind als diejenigen, die sie ursprünglich regulieren wollten.
- Interne Erfahrungen
- Der problematische Zusammenhang mit inneren Erfahrungen.
- Erfahrungsvermeidung
- Verhaltenseinschränkung
Arzneimitteltherapie und Therapie kognitiv-verhaltensbezogen (TCC) scheinen für die Behandlung von GAD wirksam zu sein (3 4 5). Bei dieser Störung können Medikamente die Angstsymptome wirksam lindern. Allerdings scheinen sie keinen signifikanten Einfluss auf die Sorgen zu haben, die das Markenzeichen von GAD sind (3).

Theoretische Referenzmodelle für generalisierte Angststörungen
Sorgenvermeidungsmodell und DAG (MEP)
Das Sorgenvermeidungsmodell und die DAG (6) basieren auf Mowrers Bifaktortheorie der Angst (1974). Dieses Modell wiederum leitet sich vom Modell der emotionalen Verarbeitung von Foa und Kozak ab (7–8).
Der Europaabgeordnete definiert Sorgen als eine gedankenbasierte verbale und sprachliche Aktivität (9), die erlebte mentale Bilder und die damit verbundene somatische und emotionale Erregung hemmt. Diese Hemmung somatischer und emotionaler Erfahrungen verhindert die emotionale Verarbeitung von Furcht was theoretisch für eine ordnungsgemäße Anpassung und Ausrottung notwendig ist (7).
Modell der Intoleranz gegenüber Unsicherheit (MII).
Gemäß dem Intoleranz-von-Unsicherheits-Modell (MII). Personen mit GAD empfinden Situationen der Unsicherheit oder Unklarheit als stressig und lästig und leiden unter chronischen Sorgen als Reaktion auf solche Situationen. (10)
Diese Personen glauben, dass Sorgen ihnen helfen oder ihnen helfen, mit gefürchteten Ereignissen effektiver umzugehen oder das Eintreten solcher Ereignisse zu verhindern (11 12). Diese Sorge führt zusammen mit den damit einhergehenden Angstgefühlen zu einer negativen Herangehensweise an das Problem und zu kognitiver Vermeidung, die die Sorge verstärkt.
Insbesondere Personen, die eine negative Herangehensweise an das Problem : (10)
Diese Gedanken verstärken Sorgen und Ängste nur (10).
Das metakognitive Modell (MMC)
Das metakognitive Modell (MMC) von Wells geht davon aus, dass Personen mit GAD zwei Arten von Sorgen haben: Typ 1 und Typ 2. Sorgen vom Typ 1 betrifft alle Sorgen über nicht-kognitive Ereignisse wie äußere Situationen oder körperliche Symptome (Wells 2005).
Laut Wells machen sich Menschen mit GAD Sorgen um Typ-1-Sorgen. Sie befürchten, dass die Sorge unkontrollierbar ist und an sich gefährlich sein könnte. Diese Sorge um die Sorge (d. h. Meta-Sorge) wird von Wells genannt Sorgen vom Typ 2 .
Sorgen vom Typ 2 sind mit einer Reihe ineffektiver Strategien verbunden, die darauf abzielen, Sorgen durch Versuche zu vermeiden, Verhaltensweisen, Gedanken und/oder Emotionen zu kontrollieren. (10)

Modell der Emotionsderegulierung
Das Modell der Deregulierung von Emotionen (MDE). Es basiert auf der Literatur der Emotionstheorie und der Regulierung emotionaler Zustände im Allgemeinen . Dieses Modell besteht aus vier Hauptfaktoren: (10)
Akzeptanzbasiertes Modell der generalisierten Angststörung (MBA)
Laut den Autoren Roemer und Orsillo umfasst der MBA vier Aspekte:
In diesem Sinne schlagen die Macher des Modells dies vor Menschen mit GAD reagieren mit negativen Reaktionen auf ihre inneren Erfahrungen und sind motiviert, diese Erfahrungen zu vermeiden Umsetzung sowohl auf Verhaltens- als auch auf kognitiver Ebene (durch wiederholte Teilnahme am Prozess). Sorge ).
Wir können sagen, dass die fünf theoretischen Modelle einen sehr wichtigen Teil gemeinsam haben: die Vermeidung interner Erfahrungen als Bewältigungsstrategie. In den letzten Jahren hat die Forschung erhebliche Fortschritte bei der Theoriebildung der Störung gemacht. Es scheint jedoch klar, dass die Grundlagenforschung, beginnend mit der Untersuchung der prädiktiven Komponenten dieser fünf Modelle, fortgesetzt werden muss.