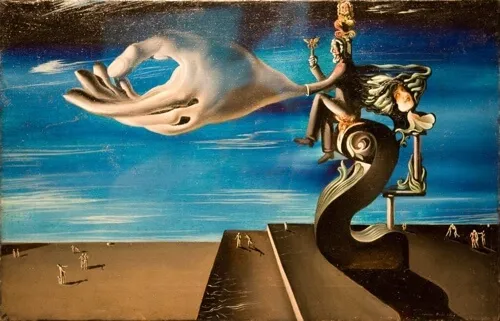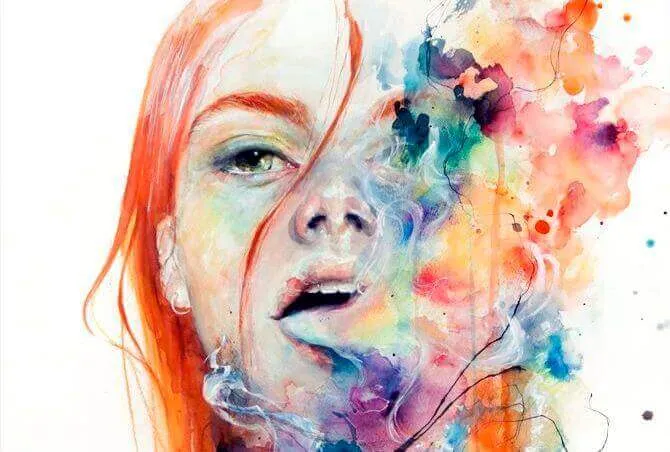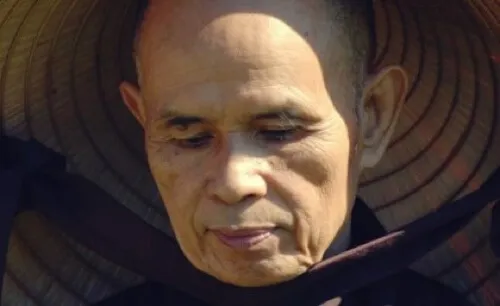1980 wurde der Begriff „Posttraumatische Belastungsstörung“ (PTSD) aus der psychiatrischen Terminologie geprägt und in die diagnostische Klassifikation der American Psychiatric Association (DSM-III) aufgenommen. Bis dahin Es wurden viele Definitionen und diagnostische Kategorien für die Kriegsneurose vorgeschlagen .
Während des Ersten Weltkriegs sprach man vom Schützengräbenfieber, um die mit dem Kampfstress verbundenen Anomalien zu erklären. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff traumatische Kriegsneurose übernommen.
Während des Vietnamkrieges wandelte sich der Begriff von einer schweren Stressreaktion zu einer adaptiven Störung des Erwachsenenlebens. Und nach diesem Konflikt wurde es Vietnam-Syndrom genannt. Gerade aufgrund dieses Krieges und aufgrund des gesellschaftlichen Drucks wurde dieses Konzept schließlich in die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) umdefiniert und entwickelte sich zu einer der wichtigsten diagnostischen Erkrankungen in der Gruppe der Angststörungen. Im militärischen Kontext werden wir PTSD als Synonym für Kriegsneurose bezeichnen.

Definition und Ursprung der Kriegsneurose oder PTSD
Jeder ist mit stressigen oder traumatischen Situationen konfrontiert. In diesem Sinne kommt es bei Stresssituationen besonderer Art und Intensität zu einem plötzlichen und absoluten Ungleichgewicht in der psychischen Struktur sowie zu einer Blockade der Fähigkeit, sich an die Umwelt anzupassen und sich gegen sie zu verteidigen. Das heißt Die Situation führt dazu, dass das Individuum in jeder Hinsicht deklassiert wird, sodass es nicht mehr in der Lage ist, anpassungsfähig zu reagieren. An diesem Punkt nimmt traumatischer Stress Gestalt an.
Die Ursachen einer Kriegsneurose oder PTSD sind alle Erfahrungen oder Umweltumstände, die potenziell zu psychischen Traumata führen können. Dieses Syndrom entsteht normalerweise als Folge der Belastung durch Stressfaktoren, die die geistige und körperliche Integrität des Einzelnen ernsthaft gefährden. Dazu müssen wir hinzufügen die subjektive Wahrnehmung von Angst seitens der Person und ihrer Zuschreibung persönlicher Unfähigkeit, mit dieser Situation umzugehen.
- Der Grad der Exposition, Beteiligung und Nähe des Subjekts zum traumatischen Ereignis.
- Die Art des Traumas, dem die Person ausgesetzt ist.
- Die militärische Ausbildung, die sie fit hält Hypervigilanz und was sie im Falle einer gewalttätigen Haltung sehr gefährlich macht.
- Beziehungsschwierigkeiten der Autorität gegenüber Vorgesetzten. Dies kann auf mangelnde Akzeptanz eines Wechsels der Autoritätsperson oder auf mangelnden Respekt gegenüber dieser zurückzuführen sein, die seiner Meinung nach nicht über die Erfahrung verfügt, die der Soldat für die Position als notwendig erachtet.
- Die Rückkehr nach Hause. In dieser Phase entstehen Gefühle der Verlassenheit, Schuld und Verzweiflung. Viele Militärangehörige haben das Gefühl, nicht mehr Teil ihres Lebens zu sein. Sie können es erreichen fühle mich schuldig oder das Pech, den Krieg und ihre Kameraden überlebt zu haben.
- Die blutigen Erinnerungen an den Konflikt. Erinnerungen an die schrecklichen Situationen, in die sie verwickelt waren.
Symptome einer Kriegsneurose
Angstdepression Schuldgefühle Niedergeschlagenheit sind einige der häufigsten Symptome dieser Störung. Die charakteristischsten Symptome lassen sich in vier große Gruppen einteilen:
Das Ereignis noch einmal erleben: Rückblenden und Albträume
Es kommt sehr häufig vor, dass man das Geschehene mehrmals durchlebt. Emotionen und körperliche Empfindungen können so real sein wie beim ersten Mal. Jedes alltägliche Ereignis kann Flashbacks auslösen, insbesondere wenn es mit dem traumatischen Ereignis verbunden ist. Eine Möglichkeit, mit Schmerzen umzugehen, besteht darin, sich zu weigern, etwas zu fühlen und emotional in den Ruhezustand zu versetzen, um nicht zu leiden.
Aufmerksamkeit ist eines der Merkmale der Kriegsneurose
Das Individuum fühlt sich in ständiger Abwehrbereitschaft und in ständiger Gefahr. Dieser Zustand wird als Hypervigilanz bezeichnet.
Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten, der Stimmung und des Verhaltens
Die Person stellt ein eine sehr negative Einstellung vor allem gegenüber dem, was sie umgibt und gegenüber sich selbst. Zeigt Schuldgefühle und die Unfähigkeit, positive Emotionen oder Gefühle zu erleben. Es kann sein, dass sein Verhalten aggressiv und gewalttätig wird, leicht reizbar ist und eine unvorsichtige und rücksichtslose Haltung zeigt.
Posttraumatischer Stress beim Militär
Bei Soldaten gibt es eine Reihe von Faktoren, die die Kriegsneurose beeinträchtigen und mit dieser in Zusammenhang stehen. Dies sind Elemente, die in vielen Fällen die Symptome verstärken und eine klinische Intervention erschweren.

Klinische Intervention bei Kriegsneurose
Eine Intervention im militärischen Kontext bei Kriegsneurose oder PTBS ist wirksamer, wenn es beginnt unmittelbar nach dem traumatischen Ereignis. Dies trägt dazu bei, eventuell auftretende Beschwerden und Komplikationen zu reduzieren. Eine in dieser Hinsicht weit verbreitete Technik ist die Nachbesprechung nützlich für die Integration und das Bewusstsein für traumatische Ereignisse, die die Gruppe erlebt hat.
Ein weiteres sehr wichtiges Instrument zur Vorbeugung von Symptomen ist die Psychoedukation. Präventive Psychotherapie ist ein sehr positives Instrument, um Soldaten auf die Emotionen vorzubereiten, denen sie ausgesetzt sein können.
Schließlich ist es das vorrangige Element bei der Intervention auf psychotherapeutischer Ebene, die Therapie an die Situation jedes einzelnen Patienten anzupassen. Es kann einzeln oder in Gruppensitzungen angewendet werden; Letztere sind sehr effektiv, wenn die Gruppen besonders homogen sind.